Die Rechtsquellen des Europäischen Unionsrechts am Beispiel des Umweltrechts

Menschenrechte in Europa – die Europäische Union
Januar 12, 2017
Verhofstadt und seine neuen Verbündeten – Reformer Europas? Eher nicht!
Januar 26, 2017Viele deutsche Gesetze haben einen europäischen Hintergrund. Das ist besonders stark im Rahmen der Umwelt- und Klimaschutzes der Fall. Doch mit welchen rechtlichen Handlungsmitteln stellt die EU sicher, dass die Mitgliedsstaaten ihre Vorgaben umsetzen? In diesem Artikel werden die Rechtsquellen des Unionsrechts und deren Geltung und Anwendung im nationalen Recht in aller Kürze dargestellt.
„Klar ist, die EU… ist wild hinter der Einhaltung der Grenzwerte her, (wobei sie sich auf) geltendes Recht berufen kann.“[1] So lautet ein Zitat des Oberbürgermeisters der Stadt Stuttgart, Fritz Kuhn. Die Stadt (oder wohl eher der Kessel) Stuttgart leidet schon seit Jahren an zu hoher Feinstaubbelastung. Der politische Druck, diese Belastungen zu verringern, kommt dabei aber nicht etwa von Parteien, sondern von der EU.[2] In vielen Bereichen nationaler Politik, insbesondere etwa in der Umwelt- und Klimapolitik, erteilt die EU den Mitgliedsstaaten und ihren Handlungsträgern eine Vielzahl von rechtlichen Vorgaben. So setzt sie etwa regelmäßig höhere Umweltschutzstandards als ihre Mitgliedsstaaten fest und wird von Wissenschaftlern deshalb gar als Modernisierungsmotor für das deutsche Umwelt- und Klimarecht bezeichnet.[3] Doch mit welchen rechtlichen Handlungsmitteln gibt die EU ihren Mitgliedsstaaten diese Vorgaben eigentlich genau vor? Anders gefragt: Was sind die rechtlichen Quellen des Unionsrechts und inwieweit finden diese Geltung und Anwendung im nationalen Recht? Das versuchen die folgenden Ausführungen anhand von Beispielen aus dem europäischen Umweltrecht aufzuzeigen.
Bei den Rechtsquellen des Unionsrechts wird zwischen Primärrecht und Sekundärrecht unterschieden:
Das sog. Primärrecht ist die zentrale Rechtsquelle des Europarechts und besteht aus zwei eng miteinander verbundenen völkerrechtlichen Verträgen, dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Es enthält die grundlegenden Regelungen über die Funktionsweise und Zuständigkeiten der Europäischen Union und lässt sich somit als Verfassung Europas bezeichnen.[4] In Bezug auf das Umweltrecht heißt es in Art. 3 III EUV bereits, dass „die Union auf eine nachhaltige Entwicklung Europas, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität“ hinwirkt. Die Bedeutung des Umweltschutzes in der EU wird darüber hinaus in Art. 191 AUEV deutlich, der vier umweltpolitische, „verfassungsrechtliche“ Ziele der Union nennt[5]:
- die Erhaltung und den Schutz der Umwelt, sowie die Verbesserung ihrer Qualität
- den Schutz der menschlichen Gesundheit
- die rationale Verwendung natürlicher Ressourcen
- die Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung von regionalen und globalen Umweltproblemen, insbesondere der Bekämpfung des Klimawandels
Neben den genannten zwei Verträgen gehören zum Primärrecht auch noch die Anhänge und Protokolle der Verträge (Art. 51 EUV) sowie gemäß Art. 6 I EUV die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC). In dessen 37. Artikel heißt es, dass in die Politik der Union ein „hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität“ einbezogen werden müsse. Wie die anderen Grundrechte bindet diese Vorschrift nicht nur die Organe der EU, sondern auch die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des EU-Rechts.[6]
Das sog. Sekundärrecht ist das Recht, das die Organe der Union in Ausübung ihrer durch das Primärrecht zugewiesen Kompetenzen schaffen. Die ihnen dabei zur Verfügung stehenden, bedeutendsten Handlungsformen sind gemäß Art. 288 AEUV Verordnungen, Richtlinien und Beschlüsse.[7]
Verordnungen gelten als unmittelbar bindendes Recht in jedem Mitgliedstaat. Juristen vergleichen sie von ihrer Wirkung her mit einem deutschen Gesetz (bzw. einer Rechtsverordnung). Das bedeutet, dass man sich als Bürger unmittelbar auf die Verordnung und die darin getroffenen Regelungen (etwa vor Gericht oder vor einer Behörde) berufen kann. Ein umweltrechtliches Beispiel hierfür ist die Chemikalienverordnung REACH. Sie soll ein hohes Schutzniveau für Mensch und Umwelt sicherstellen, indem Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender ihre Chemikalien registrieren müssen und für deren sichere Verwendung selbst Verantwortung tragen müssen.[8]
Richtlinien dagegen sind nur hinsichtlich des Mitgliedsstaats, an den sie gerichtet sind, verbindlich. Dem jeweiligen Mitgliedsstaat ist die Umsetzung der Richtlinie vorbehalten. Das bedeutet, dass dieser frei über Mittel und Form (meist eine Gesetzesänderung) entscheiden kann. Europäische Richtlinien entfalten also grundsätzlich keine unmittelbaren Rechtswirkungen, sondern bedürfen stets eines zweiten Akts, der Umsetzung in ein nationales Gesetz, durch den Mitgliedsstaat. Doch was passiert, wenn ein Mitgliedsstaat der EU seiner Verpflichtung zur Umsetzung der Richtlinie nicht fristgerecht nachkommt? Dann kann sich jeder einzelne Unionsbürger nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unmittelbar auf den Inhalt der Richtlinie und die darin getroffenen Regelungen berufen. Das ist deshalb so, weil der Mitgliedsstaat es ja sonst in der Hand hätte, die Rechtsfolgen einer Richtlinie hinauszuzögern, indem er diese einfach nicht umsetzt. Die Unionsbürger können sogar einen Haftungsanspruch gegenüber dem Staat haben, wenn ihnen durch die nicht fristgerechte oder unzureichende Umsetzung von Richtlinien ein (meist wirtschaftlicher) Schaden entstanden ist.[9]
Nehmen wir als Beispiel Stuttgart: Mit der sog. „Richtlinie über Luftqualität und saubere Luft für Europa“ (2008/50/EG) verpflichtet die EU die Behörden der Mitgliedsstaaten dazu, Maßnahmen zu ergreifen um verbindlich festgelegten Immissionsgrenzwerte einzuhalten, zum Beispiel durch einen Luftreinhalteplan. Diese Vorgabe musste der deutsche Gesetzgeber umsetzen, was er durch Änderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) getan hat. Diese europäische Richtlinie hat damit also zu einer Verbesserung der Luftqualität beigetragen.
Bleiben noch die ebenfalls sekundärrechtlichen Beschlüsse. Sie können an Mitgliedstaaten, Unternehmen oder Einzelpersonen oder an die Allgemeinheit gerichtet sein und sind in allen ihren Teilen verbindlich. Allerdings sind Beschlüsse, die sich nur an ganz bestimmte Adressaten richten, auch nur für diese verbindlich.
Zusammenfassung:
Die EU ist eine besondere, supranationale Organisation. Denn anders als die klassischen Organisationen des Völkerrechts, etwa den Vereinten Nationen (UNO), denen es an einer eigenständigen Gesetzgebungskompetenz fehlt, kann die EU selbstständig und für ihre Mitglieder verbindlich Recht setzten oder zumindest Vorgaben für zukünftige Politiken ihrer Mitgliedsstaaten festlegen. Das kann man sehr gut an der deutschen Umweltgesetzgebung sehen, die stark durch das EU-Recht geprägt ist, was dazu führt, dass mehr deutsche Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen getroffen werden müssen. Auf diese Weise gelingt es der EU ihre Mitgliedsstaaten zu Maßnahmen zu zwingen, die sie vielleicht alleine nicht in dieser Form oder Intensität verabschiedet hätten. In der Umweltpolitik kann sie auf diese Weise als Modernisierungsmotor wirken und auch einen Stuttgarter Oberbürgermeister unter Druck setzen.
Zum Autor:
Fabian Schmitt studiert Rechtswissenschaften an der Eberhard Karls Universität in Tübingen. Er ist Studierendensprecher an seiner Fakultät und belegt den Schwerpunkt „Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt“. Ende 2015 moderierte er eine Podiumsdiskussion zum Thema „Demokratische Legitimation in Europa“ bei der u.a. der neue Chef der Europäischen Linken Gregor Gysi teilnahm.[10]
Quellenangabe:
[1] http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.fritz-kuhn-zu-feinstaub-ich-will-am-liebsten-keine fahrverbote.039e8408-ee8c-4671-9d59-c2dd70cca10a.html (Stand: 04.01.2017).
[2] Aktuell dazu etwa: http://www.focus.de/regional/stuttgart/umwelt-feinstaub-stuttgarts-ob-glaubt-an-einsichtige-buerger_id_6459787.html (Stand: 09.01.2017).
[3] Kloepfer, Umweltschutzrecht, 2. Auflage, § 7 Rn. 2.
[4] Rudolf Streinz, Europarecht, 10. Auflage, Rn. 448; wobei sich darüber streiten lässt, ob die EU mangels Staatsqualität überhaupt „verfassungsfähig“ ist.
[5] Die Umweltpolitik der EU ist übrigens erst seit 1993 in den Verträgen der EU verankert!
[6] Erbguth/Schlacke, Umweltrecht, 5. Auflage, § 7 Rn. 5.
[7] Daneben gibt es auch noch Beschlüsse, sowie Empfehlungen und Stellungnahmen.
[8] Mehr zu REACH: http://www.reach-info.de/ (Stand: 13.01.2017)
[9] Erbguth/Schlacke, Umweltrecht, 5. Auflage, § 7 Rn. 15.
[10] https://www.jura.uni-tuebingen.de/fakultaet/nachrichten/151110_podiumsdiskussion-demokratie-europa-gysi










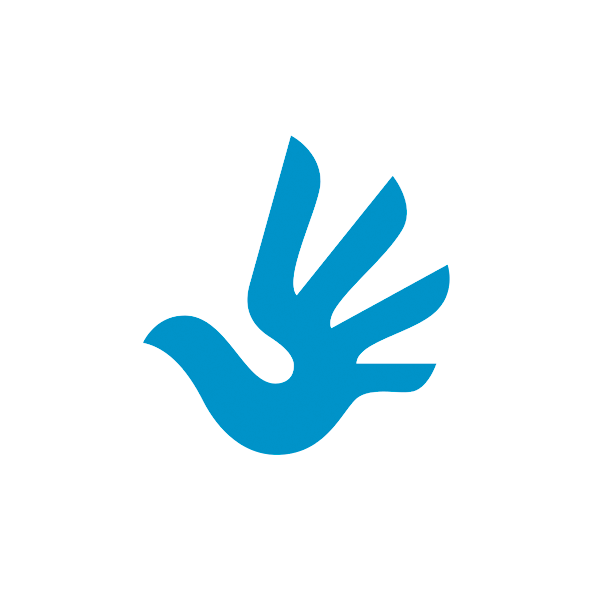
1 Kommentar
hallo,
wir leben in einer globalisierten Welt und deswegen finde ich es wichtig mit unseren europäischen Nachbarn zu sprechen und gemeinsam ein starkes Europa aufzubauen und uns nicht wieder vormachen zulassen das der Andere unser Feind ist und uns etwas wegnehmen will, sondern unser Freund,
und mit ihm das zu teilen was da ist.
Dieter